Über die Wissenschaft als Beruf(ung) wurde gerade aus soziologischer Perspektive schon viel geschrieben. Nicht erst seit Max Webers berühmten Aufsatz von 1919 ist der „wilde Hazard“ (ebd.), der die wissenschaftliche Karriere dominiert, prominenter Ankerpunkt für Kritik und Reformbestrebungen. Doch dieser Blogbeitrag soll sich nicht nur dem Weg und Unwegbarkeiten in der academia widmen, sondern vielmehr versuchen, einen Ausblick auf eine Praxis der Selbstsorge aus Sicht der wissenschaftlichen Mitarbeiter_innen zu wagen, vornehmlich in der Promotionsphase.
Dies, weil gerade diese Personengruppe von einer Vielzahl spannender Umstände begleitet wird, die beachtenswert sein können. Spätestens seit der Novellierung des Hochschulrahmengesetzes von 2007, verknüpft mit der sinkenden Grundfinanzierung der Universitäten und Hochschulen in Deutschland und zunehmender (wissenschafts-)politischer Interventionsmöglichkeiten, verschärft sich Wettbewerbssituation deutlich, mit vielfältigen und gedenderten Konsequenzen, gerade für den Mittelbau: Die weit verbreitete Teilzeitbeschäftigung bei faktischer Vollzeittätigkeit, zudem befristete Arbeitsverträge unterschiedlichster Kürze, Kettenverträge und, für externe Doktorand_innen häufig nicht sozialversicherungspflichtigen Stipendien, führen bekanntermaßen zu einer massiven Prekarisierung des wissenschaftlichen Mittelbaus, welche, so hat die DGS vergangenen Monat in ihrem Positionspapier ebenfalls festgehalten, den Wissenschaftsstandort Deutschland zusammen mit einer destruktiven, fortschreitenden Ökonomisierung der Hochschulen und inszeniertem Wettbewerb langfristig gefährdet (DGS 2015).
Das seit vergangenem September novellierte neue Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) hat diesbezüglich auch nur wenig Potential auf Verbesserung der Situation des akademischen Personals mit sich gebracht (exempl. GEW 2015). Weiter sind viele Regelungen im Gesetz nicht bindend formuliert, beispielsweise die Vertragslaufzeit bei Beschäftigung in Drittmittelprojekten. Soll ist hier das Zauberwort.
Kurzum: Die Qualifikationsphase im Wissenschaftsbetrieb ist und bleibt ein Wagnis (exempl. Burkhardt, Anke (Hg.) 2008). Planbarkeit oder zumindest mittelfristig absehbare Beschäftigungs- und damit Einkommenssituationen fehlen in der vielbeschworenen Rush Hour des Lebens, also dem biographischen Zeitraum, der auch mit Familiengründung einhergeht. Dies führt, so hat auch die DGS festgehalten, mitunter dazu, das viele sich bewusst gegen eine wissenschaftliche Karriere entscheiden, wohlgemerkt mit gender-bias (exempl. Briedis, Kolja / Jaksztat, Steffen / Preßler, Nora / Schürmann, Ramona / Schwarzer, Anke 2014) oder auswandern (exempl. Remhof, Stefan 2008). Auch die Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) der Bundesregierung sieht in den Rahmenbedingungen des deutschen Wissenschaftsbetriebs den Hauptgrund für den akademischen Brain Drain (EFI-Gutachten 2014), wenngleich nicht der Schwerpunkt der Kritik hierbei auf der Beschäftigungssituation lag.
Was in dieser Situation von wissenschaftlichen Mitarbeiter_innen erwartet wird und geleistet werden muss, ist hinlänglich bekannt. Flexibilität bezogen auf Arbeitsort, Zeit und Umfang, hohe Publikationsleistungen und -frequenzen, hohe Frustrationstoleranz, immense Leistungsbereitschaft sowie Engagement und vieles mehr. Kurzum und vielleicht etwas überspitzt: Bedingungslose Aufopferungsfähigkeit zum Beruf, oder besser: zur Berufung, Wissenschaft.
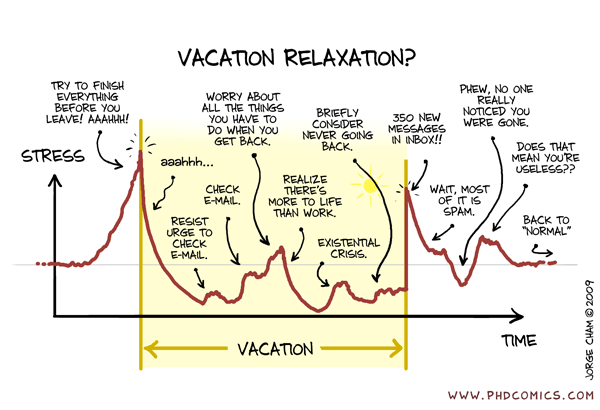
Mitunter führt das auch dazu, dass der Jahresurlaub nicht zur Erholung der Produktivität beiträgt, Erkrankungen ignoriert oder weggeputscht und Mittagspausen am Schreibtisch verschlungen werden, um weiter arbeiten zu können. Der Druck, zu schreiben, ist für viele groß.
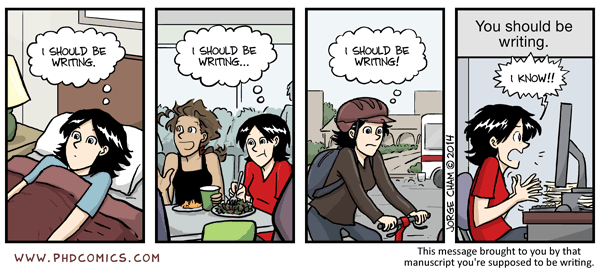
Hinzu kommt eine weitere Besonderheit des deutschen Hochschulsystems im Promotionsverhältnis, dass betreuende und begutachtende Personen von Dissertationen sowie direkte Vorgesetzte häufig ein und dieselbe Person sind. Dies führt nicht selten zu Konflikten und auch problematischen Abhängigkeitsverhältnissen, die Unzufriedenheit mit der Betreuung in der Promotionsphase ist nicht selten (exempl. Jaksztat, Steffen / Preßler, Nora / Briedis, Kolja 2012).

Was, neben wissenschaftspolitischen Forderungen, wie die der DGS und das Templiner Manifest, kann getan werden, um die Situation für den wissenschaftlichen Nachwuchs zu verbessern?
Selbstverpflichtungen von Hochschulen zu guten wissenschaftlichen Arbeitsverhältnissen, wie beispielsweise der Herrschinger Kodex, sind hier ein Ansatzpunkt. Weitergehend beispielsweise fragten aber etwa Simone Menz, Alexander Wedel und Nicole Runge im Verbundvorhaben WiFraWi unter anderem nach der Situation von Care in Wissenschaft und Forschung und schlagen ein Konzept von Wissenschaft in fürsorglicher Verantwortung als Gleichstellungsperspektive vor.
Nun, aber die Überschrift spricht von Selbstsorge, weswegen nun nach all den Rahmenbedingungen und Manöverkritik auch das Handeln der einzelnen Personen reflektiert und zur individuellen Reflexion darüber angeregt werden soll.
An den Rahmenbedingungen selbst kann man individuell häufig wenig bis gar nichts verändern – von einem Wechsel der Stellen oder Betreuungsperson mal abgesehen. Doch jede einzelne Person im Wissenschaftsbetrieb bewegt sich in einem Spannungsverhältnis von unterschiedlichen, auch externen, Anforderungen und der eigenen Leistungsfähigkeit. Diese gilt es, zu identifizieren, zu vereinbaren und zu balancieren. Dabei ist es vermutlich zentral, auch Nein sagen zu können und nicht alle Arbeit, möglichst noch gleichzeitig, erledigen zu wollen. Nein zu sagen zum Arbeiten im Urlaub. Die E-Mails nicht per Smartphone abzurufen und so ständig erreichbar zu sein. Krank-sein krank-sein zu lassen und sich lieber zu pflegen, zu erholen, als auf Sparflamme weiter zu arbeiten. Eine strukturierte, strategisch planvolle Herangehensweise an die Promotion ist ein anderer Weg, der den Umgang mit der Planungsunsicherheit und Unwegbarkeit schon zu Beginn des akademischen Karrierewegs und bestimmt auch in der Lage, einen Teil des Unbehagens und des Drucks zu mindern. Doch wichtiger erscheint hier die Bedeutung von Netzwerken, vielmehr noch freundschaftlichen Beziehungen am Arbeitsplatz, die zur Jobzufriedenheit, Produktivität und commitment beitragen und gleichzeitig stressmoderierend wirken (vgl. Azar, Beth 2012). Dies leuchtet ein, denn wer versteht, was man gerade erlebt und worauf man sich eingelassen hat mit dem Ziel, zu promovieren, kann auch unterstützen – sei es allein durch die Konversation.
tl;dr: Doktorand_innen, seht zu, dass ihr nicht alleine promoviert.
Dr. Yves Jeanrenaud hat Soziologie, Gender Studies und Medienwissenschaften in Basel und Tübingen studiert. Seine Promotion schloss er an der Technischen Universität München ab zum Thema „Engineers‘ Parenting – Zum Verhältnis von Ingenieurinnen und Ingenieuren zu Elternschaft“. Er arbeitet an der Professur Gender Studies in den Ingenieurwissenschaften unter anderem im Teilprojekt 3 des Forschungsclusters ForGenderCare „Die Rolle einer gender- und diversityorientierten Technikentwicklung bei der Teilhabe von Seniorinnen und Senioren im demografischen Wandel“. Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Gender-Theorie, Geschlechterdifferenz und Erwerbsarbeit, Familiensoziologie und Biographieforschung.
Kommentare
Eine Antwort zu „Selbst(sorge) wissenschaftliche_r Mitarbeiter_innen“
[…] Nach den vielen Aktivitäten der Initiative für Gute Arbeit in der Wissenschaft, einer Erklärung der Fachgesellschaft DGS zu den Folgen der Ökonomisierung der Wissenschaft für die Beschäftigten und der jüngst stattgefundenen Konferenz zur “Soziologie als Beruf” gibt es nun Blogbeiträge zum Thema. Auf dem Blog der Fachgesellschaft, dem “Sozblog”, geht es in einem aktuellen Beitrag um Strukturprobleme und um Strategien der Selbstsorge aus Genderperspektive. […]